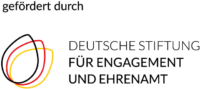Bei der Methode „Ich-Karten“ handelt es sich um ein Kennenlern-Spiel. Sie ist für Gruppen geeignet, deren Teilnehmende sich noch gar nicht kennen. Sie ist auch für Gruppen geeignet, deren Teilnehmende sich bereits kennen, aber noch mehr übereinander wissen möchten.
Die Teilnehmenden finden sich in einem Kreis zusammen. Dabei ist es egal ob sie stehen oder auf Stühlen oder auf dem Boden sitzen. Jede*r bekommt 3-5 Zettel und einen Stift ausgeteilt. Auf jeden Zettel schreiben oder malen die Teilnehmenden die Antwort auf jeweils eine Frage. Die Fragen können lauten:
- Wie lautet mein Name (und wie möchte ich genannt werden)?
- Wie alt bin ich?
- Was esse ich am liebsten?
- Welches ist mein Lieblingstier?
- Was ist mein liebstes Hobby?
- Wie viele Geschwister habe ich?
- Was möchte ich später gerne beruflich machen?
- Was war mein schönstes Erlebnis?
Die Fragen richten sich nach dem Alter der Teilnehmenden sowie der Zusammensetzung der Gruppe. Sind Menschen mit Behinderung(en) beteiligt, können Fragen gestellt werden, die die Teilnehmenden füreinander sensibilisieren. Zum Beispiel:
- Was ist für mich im Alltag besonders herausfordernd?
- Was stellt in meinem Alltag eine Barriere dar?
- Was hilft mir, mich in meinem Alltag zurechtzufinden?
- Wie sollten sich andere Menschen mir gegenüber (nicht) verhalten?
- Was kann ich besonders gut?
- Wann bin ich über mich hinausgewachsen?
- Was wünsche ich mir von anderen?
Die Teilnehmenden können die Karten entweder im Kreis ausfüllen oder sich zurückziehen, um die Fragen in Ruhe für sich zu beantworten.
Haben alle ihre Karten ausgefüllt, wird reihum je eine Frage beantwortet. Dabei legen die Teilnehmenden ihren Zettel vor sich. Ist eine Runde abgeschlossen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich gegenseitig Fragen zu ihren Antworten zu stellen. Danach geht es mit der nächsten Frage reihum weiter.
Bei dieser Kennenlern-Methode lernen die Teilnehmenden mehr über einander als nur den Namen und das Alter. Fragen, die Aufschluss über das Leben mit Behinderung(en) geben, stellen eine niederschwellige Möglichkeit für Menschen ohne Behinderung(en) dar. So können sie einen Einblick in ein für sie unbekanntes Alltagsleben bekommen. Gleichzeitig werden sie für die Bedarfe von Menschen mit Behinderung(en) sensibilisiert.
-
Dieses Angebot bezieht sich auf die Inklusion von Menschen mit folgenden Behinderungsformen
- Körperliche Behinderung
- Lernbehinderung / -schwierigkeiten
- Psychische (seelische) Behinderung
- Sinnesbehinderung
- Hörbehinderung
- Sehbehinderung
- Sprachbehinderung
Weitere Informationen
Vorab muss abgeklärt werden, ob die Teilnehmenden Unterstützung beim Ausfüllen der Karten benötigen. Hilfe kann dann entweder durch eine anleitende Person oder eine*n anderen Teilnehmenden geleistet werden.
Bitte beachten: Je nach Behinderungsform kann eine persönliche oder technische Assistenz/Pflege erforderlich sein.
-
Vielfaltsmerkmale
- Identitätspolitische Herkunft
- Migration
- Religion / Weltanschauung
- Sexuelle Orientierung / Geschlechtliche Identität
-
Altersgruppen
- Erwachsene
- Jugendliche
- Kinder
- 6 bis 12 Jahre
-
Anwendende
- (Jugend-)Gruppenleitende
- Ehrenamtliche
- Eltern
- Fachkräfte
-
Handlungsfelder
- Bildung und Arbeit
- Arbeit / Beschäftigung
- Ausbildung / Studium
- Bildung / Erziehung / Schule
- Übergang Schule - Beruf
- Identität und Persönlichkeit
- Identitätsentwicklung
- Persönlichkeit stärken / Empowerment
- Kultur und Freizeit
- Ferienfreizeit
- Interkulturelle Kommunikation
- Politik und Gesellschaft
- Diskriminierung
- Mobilität / Barrierenüberwindung
- Netzwerk / Öffentlichkeit / Politik
- Sensibilisierung
- Teilhabe
- Begegnung
- Partizipation
- Bildung und Arbeit
-
Organisationen
- Betriebe / Beschäftigungsförderung
- Bildungseinrichtungen
- Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit
- Elternverbände / -initiativen
- Migrant*innenorganisationen
- Sonstige Vereine / Verbände / Initiativen
-
Gruppengröße
- Bis 10 Personen
Weitere Informationen
ab 4 Personen -
Fläche
- Kein konkreter Flächenbedarf
-
Durchführungsorte
- In Präsenz
- Online
Weitere Informationen
An den Ort der Durchführung gibt es keine besonderen Anforderungen. Die Teilnehmenden müssen lediglich entlang ihrer persönlichen Bedarfe die Möglichkeit haben, die Karten ausfüllen zu können. Die Methode kann auch online durchgeführt werden. Dabei halten die Teilnehmenden ihren ausgefüllten Zettel einfach in die Kamera, sobald sie an der Reihe sind. Voraussetzung dafür ist, dass Teilnehmende mit Assistenzbedarf eine unterstützende Person vor Ort haben. -
Material
- Eigenes Material
Weitere Informationen
Für die Methode werden Karten oder Papierstreifen sowie Stifte benötigt.
Personalbedarf
Anzahl: 1 Person
Weitere Informationen
Wenn die Teilnehmenden keine weitere Unterstützung beim Ausfüllen der Karten benötigen, reicht eine betreuende Person aus. Weiterer Personalbedarf richtet sich nach den Bedarfen der Teilnehmenden.
Zeitaufwand
Vorbereitung: 0,5 Stunde(n)
Durchführung: 0,5 Stunde(n)
Vorab muss das Material bereitgestellt und ein Fragenkatalog zusammengestellt werden.
Die Dauer der Durchführung ist von der Gruppengröße abhängig.
Kostenaufwand
Kosten
kostenlos
Weitere Informationen
Stifte und Papier/Karten können in der Regel aus dem eigenen Bestand zur Verfügung gestellt werden. Daher fallen keine Kosten für die Durchführung der Methode an.
Ansprechperson / -organisation
- Kubus e.V.
Inklumat-Team
E-Mail: inklumat@kubusev.org
Website: www.kubusev.org/projekte/djingo-2-die-jugendarbeit-inklusiv-gemacht-offensive
Weitere Informationen
Ehrenamtsbörse „Itimi“
Sie haben selbst eine Behinderung und möchten sich ehrenamtlich engagieren?
Sie haben Angebote, bei welchen sich Menschen mit Behinderungen ehrenamtlich einbringen können?
Dann informieren Sie sich gerne bei der Ehrenamtsbörse Itimi über Ihre Möglichkeiten!
Rollstuhlkarte „Wheelmap“
Sie bewegen sich mit einem Rollstuhl fort und möchten überprüfen, ob Ihr Ziel rollstuhlgerecht ist?
Sie planen ein Angebot und möchten sicherstellen, dass der Durchführungsort rollstuhlgerecht ist?
Dann nutzen Sie die Wheelmap!