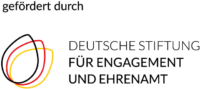Viele Menschen mit Schwerbehinderung finden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz. Als Alternative bleibt dann oft nur die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die Abkürzung dafür ist WfbM. Allerdings wollen manche Menschen nicht in einer WfbM arbeiten. Deshalb gibt es zusätzlich auch sogenannte Inklusionsbetriebe. Hier arbeiten Menschen ohne Behinderungen mit Menschen mit Schwerbehinderung zusammen. In einem Inklusionsbetrieb muss eine bestimmte Anzahl an Menschen mit Behinderungen arbeiten. Sonst ist es kein Inklusionsbetrieb. In Inklusionsbetrieben bekommen Menschen mit Behinderung den Mindestlohn bezahlt. Manchmal bekommen sie auch mehr bezahlt.
Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Betriebe oder Betriebe in der Trägerschaft von öffentlichen Arbeitgebern, die Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anbieten. Sie sind nicht zu verwechseln mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), weil sie dem Charakter eines gewinnorientierten Unternehmens entsprechen. Dort müssen mindestens 30 und maximal 50 Prozent Menschen mit Behinderungen beschäftigt sein, damit diese als Inklusionsbetrieb gelten.
Ziel dieser Betriebe ist es, Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz anzubieten, der einer Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt ähnlich ist bzw. entspricht. Zudem findet dort eine Begegnung zwischen Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderungen statt. Wie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) sollen Sie Menschen mit Behinderungen einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Damit eine wirtschaftliche Chancengleichheit besteht, erhalten Inklusionsbetriebe von den Integrationsämtern einen finanziellen Ausgleich (Förderpauschalen, Nachteilsausgabe etc.) für jede schwerbehinderte Person, die dort arbeitet.
Inklusionsbetriebe und deren Aufgaben und finanzielle Förderung werden gesetzlich in den §§ 215-218 SGB IX geregelt. Diese bieten Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung, die ohne eine besondere Unterstützung oder einen besonderen Rahmen nicht in der Lage wären, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein. Trotzdem stehen diese Unternehmen im wirtschaftlichen Wettbewerb und fordern von ihren Beschäftigten ein bestimmtes Maß an Leistung, dass im Durchschnitt 60 bis 70 Prozent einer normalen Leistungsfähigkeit beträgt.
Nach § 215 Abs 1 SGB IX gehören zu den Zielgruppen Menschen, „deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt“. Gründe dafür können die Art und Schwere der Behinderung sein sowie zusätzliche Umstände, die eine Vermittlung hemmen (z.B. Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, mangelnde Qualifizierung). Weitere Zielgruppen sind Abgänger*innen von Förderschulen oder Menschen, die bisher in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) gearbeitet haben. Dieser Personenkreis wurde um Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert (§ 215, Art. 2, Abs. 1 SGB IX). Damit jedoch der nicht selten hohe Arbeits- und Termindruck bewältigt werden kann, sind mindestens die Hälfte der Mitarbeitenden Menschen ohne Behinderungen.
Für das Jahr 2022 listet die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V. insgesamt 1.030 Inklusionsbetriebe auf, welche knapp 30.000 Menschen (davon knapp 13.000 mit Schwerbehinderung) beschäftigen. Die gesamte Wirtschaftsleistung der Betriebe dürfte bei etwa einer halben Milliarde Euro liegen. Inklusionsbetriebe können dabei rechtlich selbstständige Unternehmen sein oder unselbständige Betriebe und Abteilungen von Unternehmen sowie öffentliche Arbeitgebende.
Inklusionsbetriebe bieten reguläre Arbeitsplätze zu gängigen Bedingungen wie beispielsweise den ortsüblichen oder tariflichen Lohn, Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung sowie eine unbefristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Die Geschäftsfelder der Inklusionsbetriebe sind sehr unterschiedlich. Dazu gehören unter anderem die industrielle Produktion, Dienstleistungen, Einzelhandel oder Gastronomie. Bei den Rechten und Pflichten der Beschäftigten gibt es keine Unterschiede. Entsprechend sind auch die Erwartungen an die einzelnen Mitarbeitenden – besondere Schonräume sind zum Beispiel oft nicht vorhanden. Jedoch werden der Betrieb und die Arbeit so organisiert, dass Einschränkungen, die sich aus einer Behinderung ergeben, berücksichtigt werden. Dies kann bedeuten, dass Arbeitsplätze eine besondere Ausstattung erhalten, dass Arbeitsprozesse für jede Person angepasst werden oder dass die Arbeit so organisiert wird, dass in leistungsintensiven Phasen mehr und in weniger leistungsintensiven Phasen weniger gearbeitet wird.
01.09.2024